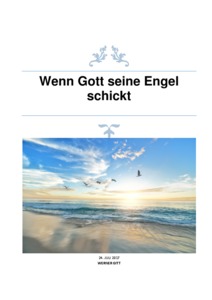Beiträge zum Download
Bibelorientierte Beiträge
Wenn Gott seine Engel schickt
Es geschah in schier endloser Schneewüste[1]
Mitte Januar 1945 begann die Großoffensive der Roten Armee auf Ostpreußen, die östlichste Provinz des damaligen Deutschen Reiches. Ich gehörte damals zur 4. Armee (ZBV-Stab; „Zur besonderen Verwendung“), und wir 300 Soldaten hielten uns in einem kleinen Dorf im nördlichen Ostpreußen auf (Beerendorf, Kreis Labiau), dessen Bewohner bereits ausnahmslos geflüchtet waren. Es war am 31. Januar um 5 Uhr früh, als ein erster Granatwerfer das Dorf beschoss und russische Soldaten anrückten. Ein Entkommen schien aussichtslos. Und doch versuchte ich, in den nahegelegenen Wald zu fliehen. Wie ich aber gar bald feststellen musste, waren die Russen auch bereits hierhin gelangt. Zusammen mit drei anderen Kameraden geriet ich dort in russische Gefangenschaft. Bald kamen noch weitere 18 Gefangene hinzu. Was aus den übrigen Soldaten geworden ist, weiß ich nicht. In einem Haus, das dort mitten im Wald stand und bereits als russische Kommandantur eingerichtet worden war, wurden wir in einem Raum gefangen gehalten. Es war sehr kalt, und wir bekamen weder etwas zu essen noch zu trinken. Die umliegenden Orte waren ebenfalls in russischer Hand. Mit uns hatte man einen besonderen Plan. Wir wurden durch verschiedene Orte getrieben, um den dort stationierten Rotarmisten zu zeigen: Es gibt bereits deutsche Gefangene! Der Krieg war ja noch nicht zu Ende, und so wollte man den Soldaten auf diese Weise Mut machen zum Weiterkämpfen.
Wir 22 Soldaten empfanden uns als den spärlichen Überrest einer zerschlagenen deutschen Armee. Gleich nach dem Tag der Gefangennahme begann nun für uns jeden Morgen ein etwa 40 Kilometer langer Tagesmarsch – und das ohne einen Bissen Essen oder einen Schluck Wasser. Auf diesem Marsch mussten wir immer wieder durch russische Einheiten und die uns schon bekannten Ortschaften hindurch. Wir 22 Jammergestalten waren bei klirrender Januarkälte von etwa minus 15 bis 20 Grad nur sehr notdürftig gekleidet, denn russische Soldaten hatten uns Uniform und Stiefel abgenommen und uns irgendwelche Lumpen hingeworfen. So trotteten wir hungrig, frierend und todmüde fünf Tage durch die schneebedeckte und in der Sonne glitzernde Winterlandschaft – geordnet in einer Kolonne und immer zu zweit nebeneinander. Damit wir nicht fliehen konnten, wurden wir ständig von sechs bewaffneten Soldaten bewacht. Abends kehrten wir von diesem Rundmarsch wieder in das Waldhaus zurück und wurden gemeinsam in einem kalten, dunklen Raum eingesperrt. Tag für Tag verging so in gleicher Weise. Auch am fünften Tag kamen wir wieder an der uns schon bekannten zwei Kilometer langen, von hohen Bäumen umsäumten Allee vorbei.
Auf diesem Weg sollte uns aber etwas ganz Außergewöhnliches passieren. Während der Kamerad neben mir mit müder Stimme von seiner Hoffnung sprach, doch bald wieder zu seiner jungen Frau und seinem Töchterchen zu dürfen, richtete ich mich wieder einmal auf, um die lange Gerade entlang zu schauen. Doch da stockte mir der Atem. Vor uns stand ein prachtvoller Schimmel. Darauf saß ein blutjunger Offizier. Er trug eine knallrote Uniformjacke mit goldenen Knöpfen und Schnüren, viele Orden über der Brust, eine himmelblaue Reithose mit roten Streifen und nagelneue hellbraune Stiefel. Nach meiner Beurteilung war er so gekleidet wie man in einem Bilderbuch einen Kosaken nicht besser hätte darstellen können ‑ darum nenne ich ihn im Folgenden auch so. Weder vorher noch nachher habe ich je wieder jemanden mit solcher Uniform gesehen. Als schlügen Feuerflammen des Hasses aus seinen Augen, so wutentbrannt schaute er auf uns Gefangene herab, und ich ahnte nichts Gutes. Weil wir ja alle mit gesenkten Köpfen dahin trotteten, hatte auch keiner den uns entgegen reitenden Offizier bemerkt. Er hatte sich schon auf zehn bis zwölf Meter herangenaht, da stieß ich meinen Kameraden neben mir fest in die Seite und rief laut: „Pass auf, er kommt!“ Aber es war schon zu spät. Der Kosake hat seinem Schimmel die Sporen so tief in die Weichen gestoßen – als Reiter wusste ich, was jetzt kommt –, dass er wie ein Ungeheuer mitten durch unsere Gruppe raste. Ich konnte gerade noch die zum Feld hin abschüssige Böschung hinabspringen, alle andern aber wurden zu Boden geschleudert. Es gab ein wüstes Durcheinander. Die Wachtsoldaten waren von einfachem Rang und griffen darum nicht in die Aktion des Offiziers ein. Sie waren zwar sehr erregt, hatten aber nur die eine Sorge, dass wir nicht die Gelegenheit nützen und davonlaufen würden, aber ihre Schüsse in die Luft waren uns Warnung genug. Sie schrien immerzu mit ihrem stark russischen Akzent: „Aufstäähn, aufstäähn!“, bis wir schließlich wieder geordnet unsern Marsch fortsetzen konnten. Der Kosake war mit einem solchen Tempo durch uns hindurchgerast, dass er erst weit hinter uns wieder zum Stehen kam. Ich wusste, dass er in seiner Wut in gleicher Weise noch einmal von hinten zwischen uns rasen würde und schaute immer wieder zurück. Und dann kam er mit ungestümer Wucht und hat uns alle erneut durcheinander gewirbelt.
Mein Tiroler Kamerad und ich waren die einzigen, die noch standen. Und genau vor uns beiden hielt er seinen Schimmel so ruckartig an, dass der auf seinen Hinterbeinen vor uns hochstieg. Dann schlug der Offizier mit seiner Reitpeitsche auf uns beide ein. Vielleicht war es die russische Pelzmütze meines Kameraden, von der dieser annahm, er habe sie gestohlen; oder waren es die abwehrenden Arme gegen die Peitschenhiebe, die den Offizier glauben machte, mein Kamerad wollte nach ihm schlagen. Wutentbrannt zog der Reiter seine Pistole, zielte auf die Stirn des Kameraden und schoss ihm mit drei blitzschnell aufeinander folgenden Schüssen, wie mit einem Lineal gezogen, ein symmetrisches Dreieck in die Stirn. Es war ein grausiger Anblick, der mir unvergesslich auch heute immer wieder vor Augen steht. Der liebe Kamerad, der gerade noch von seiner Hoffnung sprach, Frau und Töchterchen doch bald wieder zu sehen, wurde durch den abgrundtiefen Hass eines Menschen so furchtbar hingerichtet und ausgelöscht. Er sank zu meinen Füßen, dann rollte er die Böschung hinunter.
Nun aber hatte der Kosake es auf mich abgesehen, und ich starrte in ein Paar flammender Augen. Es schoss mir durch den Kopf: Jetzt kommt auch mein Ende. Der Kosake hob seinen Arm wie zu einer Schießübung und richtete seine Pistole aus etwa 40 Zentimetern auf meine Stirn. Mit unsagbarem Entsetzen sah ich seinen Finger am Abzugsbügel der Pistole und wusste, dass in Bruchteilen einer Sekunde auch mein junges Leben ausgelöscht sein würde. Man muss es erlebt haben, um zu wissen, was sich gedanklich in einem Nu wie auf Zeitlupe abspielen kann. Immer das Todesdreieck auf der Stirn meines Kameraden vor Augen, türmte sich ein Heer von Gedanken, Ängsten, Bildern und Gefühlen aufeinander und übereinander, so, als wäre noch genug Zeit, über alles nachzudenken. Dazu die schmerzlichen Gedanken an die Lieben zu Hause – ich war auch jung verheiratet –, und mich befiel eine unaussprechlich tiefe Angst, jetzt auch mein hoffnungsfrohes Leben zu verlieren. Ich sah gebannt in den dunklen Lauf der Pistole, die ja nur eine Armlänge von mir entfernt war, und mit unsagbarer Angst auf den Finger am Abzug, der sich jetzt unweigerlich zum Todesschuss krümmen würde. Jäh wurde ich aus meinen bisherigen Gedanken gerissen. Mir blieb nur noch ein letzter Aufschrei: „Herr, hilf!“ Das ist doch eine Zusage Gottes: „Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten!“ (Ps 50,15). Was dann geschah, ist mir bis heute unerklärlich:
Noch bevor der Offizier seinen Finger zum Abschuss krümmen konnte, wurde er wie von unsichtbarer Hand von seinem Schimmel heruntergerissen. Was war geschehen? Plötzlich stand mitten unter uns verstörten Gefangenen ein Lastwagen, wie vom Himmel herabgelassen. Keiner von uns 21 hat auch nur das leiseste Motorengeräusch eines LKW gehört, der nun aber etwa zwei Meter neben dem Pferd stand. Auf der verschneiten Allee hätte man auf hundert Meter selbst eine Maus gesehen, umso mehr einen Lastwagen. Über die Bordwand der nach oben offenen Ladefläche des Fahrzeugs sprangen hastig sechs Männer in grünen Drillichanzügen (= Arbeitsanzug mit Jacke und Hose). Sie rissen den Offizier gewaltsam vom Pferd und hielten ihn am Boden liegend fest, und zwar so lange, bis wir Gefangenen ihm entkommen konnten. Diese sechs Gestalten blickten ausschließlich auf den am Boden liegenden Offizier, so dass wir die Gesichter unserer Nothelfer nicht sehen konnten. Eines aber fiel uns auf, dass diese sechs Männer in ihrem Erscheinungsbild völlig gleichgestaltet waren. Vor lauter Angst haben wir alle immer wieder zurückgeschaut, ob der Kosake nun erst recht noch einmal kommen würde, aber wir sahen ihn dann doch langsam von uns wegreiten in jene Richtung, aus der wir gekommen waren.
Eines hat uns danach noch lange bewegt: Wer waren diese sechs Retter, und woher kam so plötzlich dieser Lastwagen her, dessen Kommen keiner von uns weder gesehen noch gehört hatte? Als ich mich aus 30 bis 40 Meter Entfernung noch einmal umdrehte, ritt der Reiter weg; der LKW aber stand noch an demselben Platz, wo er so unversehens aufgetaucht war. Offenbar hatte er noch eine Schutzfunktion wahrzunehmen. Da wir alle dasselbe gesehen hatten, war diese sonderbare und für uns nicht erklärbare Aktion noch lange danach der einzige Gesprächsstoff. Meine Kameraden kamen über viele Fragen nicht hinweg. Für mich war das alles besonders ergreifend, denn es hatte zu meiner Errettung aus größter Todesgefahr gedient. Ich hielt das eigenartige Geschehen für das machtvolle Eingreifen Gottes. Ob die Kameraden später vielleicht auch noch zu dieser Erkenntnis gekommen sind, wenn sie an jene schrecklichen Minuten zurückdenken? Für mich bleibt es die unvergessliche und wunderbare Erfahrung: „Er wird seinen Engeln befehlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen!“ (Ps 91,11). Diese sechs Männer waren für mich nicht nur Schutzengel, wie wir ja volkstümlich auch menschliche Helfer bezeichnen, sondern in Wahrheit Boten Gottes, die er zu unserer Errettung ausgesandt hatte.
Walter Stumpf, Neustadt an der Weinstraße
Ein außergewöhnlicher Bibelbote[2]
Während des Zweiten Weltkrieges geriet ich in russische Kriegsgefangenschaft. Es waren 5000 Mann, die bei Stalino (Name der Stadt zur Zarenzeit: Jusowo; heute: Donezk) im Donezbecken in der Ukraine bei mangelhafter Verpflegung harte Arbeit im Kohlebergbau verrichten mussten. Das tägliche Arbeitssoll pro Mann war festgelegt auf den Abbau einer 10 m langen Steinkohlenwand, und zwar unter primitivsten Bedingungen. Außer Essgeschirr, Löffel und Rasierzeug durfte keiner irgendwelche persönlichen Dinge besitzen, was durch das ständige Filzen und Durchsuchen der Räume kontrolliert wurde. In dem riesigen Lagerbereich gab es somit kein Stück Papier, Schreibzeug oder gar ein Buch. Es war gegen Ende des Jahres 1946. Da hatte ich ein Erlebnis besonderer Art, wovon ich nun berichten will:
Eines Tages stand ich in der Dämmerung vor unserer Baracke, schaute in den Abendhimmel und suchte mich an Hand der jetzt mehr und mehr sichtbar werdenden Sternenbilder in Richtung Heimat zu orientieren. Wie aus der Erde gestiegen, stand plötzlich ein Hüne von einem Wachtposten mit aufgepflanztem Bajonett direkt vor mir. Er trug eine russische Uniform und die übliche Russenmütze. Weil er deutlich über 1,80 Meter groß war, musste ich (1,74 m) zu ihm hochschauen. Er fasste mich mit ungewöhnlich festem Griff am rechten Oberarm und zog mich schweigend hinter die Baracke. War das mein Ende? Als Kriegsgefangene waren wir ja schutzlos allen Unberechenbarkeiten ausgeliefert. Ich befürchtete Schlimmes. Der große Unbekannte öffnete seine Uniformjacke, legte den Zeigefinger der rechten Hand auf seinen Mund, um mit Entschiedenheit deutlich zu machen, dass jetzt kein Wort gesprochen werden darf. Dann griff er mit der Linken unter seine Uniformjacke und reichte mir ein Buch. Sollte ich es nehmen? Privatbesitz war ja streng verboten und wurde bei Entdeckung mit etlichen Tagen Bunker bei Wasser und ganz wenig Brot hart bestraft. Nun war ich dem großen Unbekannten gegenüber in einer schwierigen Lage. Lehnte ich ab, würde er vielleicht böse; nähme ich an, machte ich mich strafbar. Was tun? Zum Nachdenken ließ er mir keine Zeit, sondern drückte mir das Buch fest in die Hand.
Obwohl es schon fast dunkel geworden war, war ich doch neugierig, was das wohl für ein Buch sei. Schon beim Zufassen durchströmte mich ein unbeschreibliches Gefühl, denn Format und Stärke des Buches erschienen mir sehr vertraut. Ich schlug es auf und erkannte im Halbdunkeln: ich hielt eine deutsche Lutherbibel in Händen. Es war genau jene Jubiläumsausgabe mit Erklärungen und Konkordanz, wie ich sie seit meinem 15. Lebensjahr zu Hause besaß und die ich fast täglich gelesen hatte. Wäre dieser Wachtposten nicht gewesen, hätte ich meine unbeschreibliche Freude mit einem Luftsprung zum Ausdruck gebracht. So aber schlug ich das Buch zu, um diesem seltsamen Fremden zu danken. Als ich aber von meinem Buch aufschaute, war der Wachtposten, so plötzlich wie er vor mir stand, auch wieder verschwunden – als hätte ihn der Erdboden verschlungen.
Wer war dieser nach meiner Schätzung etwa vierzig Jahre alte stattliche Mann, dessen scharf geschnittene, aber außergewöhnlich schönen Gesichtszüge mir heute noch so gut in Erinnerung sind? Was war das für ein Erleben bei hereinbrechender Nacht in russischer Kriegsgefangenschaft?
Nur wer die Heilige Schrift liebt, kann sich in etwa vorstellen, wie mir zumute war. Ich war der reichste Mann unter 5000 Habenichtsen! Ich hatte ein Buch – inmitten einer atheistischen Welt besaß ich plötzlich eine Bibel. Sogleich wurde mir ein Problem offenbar: Wo kann ich die Bibel verstauen, wenn ich zur Schicht im Bergwerk bin? Ich hatte keine Alternativen und so versteckte ich sie in dem untersten Ende des Strohsacks meiner Schlafpritsche.
Als ich von der ersten Schicht nach diesem Erleben wieder ins Lager kam und meine Bude betrat, packte mich großes Entsetzen. Sämtliche Strohsäcke lagen in wüstem Durcheinander auf einem Haufen. Mein erster Gedanke: Wo ist meine Bibel? Sie war verschwunden! Nun gab es ein ganz merkwürdiges Gesetz Stalins, wonach der Besitz einer Bibel und Hitlers 'Mein Kampf' in Lagern erlaubt war. Wer sollte in einem russischen Kriegsgefangenenlager jemals an diese Bücher kommen, die doch dem Kommunismus entgegenstehen? Während der Zeit bei der deutschen Wehrmacht verwaltete ich mancherlei Akten und kannte daher diese nicht erklärbare sowjetische Verordnung. Im Wissen um die Gültigkeit dieses Dokuments ging ich zum russischen Lagerkommandanten – einem gefürchteten Mann –, um den Vorfall zu melden. Er war nicht wenig erstaunt, dass ich von diesem Papier wusste. Auf seine Frage, wie ich zu dieser Bibel gekommen sei, sagte ich wahrheitsgemäß: „Von einem ihrer Wachtposten!“ Ich spürte ihm seine große Erregung ab. Sofort gab er den Befehl: „Alle Wachtposten raus, antreten!“ Er befahl mir, die Front mit ihm abzuschreiten und den gesuchten Wachtposten zu identifizieren. Ich erinnerte mich sehr wohl an die markanten Gesichtszüge jenes großen Mannes und glaubte, ihn mühelos herausfinden zu können. Der Überbringer der Bibel aber war nicht dabei. Der Kommandant zuckte ratlos die Schultern und signalisierte damit das Ende dieser Suchaktion. Natürlich hätte er zu gerne herausbekommen, wer im Lager Bibeln verteilt ‑ so aber hat er die Sache nicht weiter verfolgt.
Als ich am nächsten Tag vom Bergwerk ins Lager zurückkam, war die Bibel wieder genau dort, wo ich sie versteckt hatte. Nicht nur ich, auch die Kameraden waren sprachlos und voller Fragen. Wer hat das getan? Eines wurde mir jetzt sehr klar: Dieser Bibelüberbringer gehörte nicht zur Wachtmannschaft des Lagers. Für mich war es ein Engel in Uniform! Durch die jüngsten Ereignisse gab mir Gott eine so klare Bestätigung, dass es mir zur festen Gewissheit wurde.
Die Lagerkommandantur hatte mir die Erlaubnis erteilt, jeden zweiten Sonntag einen Gottesdienst zu halten. Anfangs kamen 40 bis 50 Leute. (Im Laufe der Zeit wurden es wegen der sich verstärkt breitmachenden Hoffnungslosigkeit in unserer Situation immer weniger, so dass wir zum Zeitpunkt meiner Entlassung leider nur noch sechs bis acht Gefangene waren). Man hatte sich von der Lagerleitung hierdurch eine bessere Stimmung unter den Gefangenen erhofft. Da ich seit meinem 18. Lebensjahr viele Bibelverse und teilweise ganze Kapitel auswendig gelernt hatte, konnte ich immer wieder auf ein Gotteswort zurückgreifen – auch ohne Bibel. Jetzt aber war es mir möglich, den Kameraden aus einer echten Bibel vorzulesen. Diese Bibel ging im Lager von Hand zu Hand; jeder wollte sie haben, um darin zu lesen. Ich habe den Kameraden immer wieder gesagt: „Gott kann uns hier aus dieser Hölle herausführen, wenn wir ihm nur vertrauen.“ Wenn meine Hoffnung auf Gott auch oft müde belächelt wurde, so habe ich doch daran festgehalten und die Kameraden zu diesem Vertrauen immer wieder ermutigt. Es sollte auch nicht enttäuscht werden.
Walter Stumpf, Neustadt an der Weinstraße
Die strenge Majorin und ihr barmherziger Augenblick[3]
Worüber sollten 5000 Väter, Söhne und Brüder in russischer Kriegsgefangenschaft im beginnenden vierten Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges reden und nachts träumen als endlich nach Hause zu dürfen, endlich entlassen zu werden! Dieser Wunsch wurde immer stärker, je menschenunwürdiger die Verhältnisse im Lager und unerträglicher die Arbeit in den Kohlebergwerken wurden. Arbeit, Arbeit und immer nur Arbeit war die Forderung der Russen; Heimkehr, Heimkehr hingegen beherrschte alles Denken und Wünschen der gestressten und verbitterten Gefangenen. Dieser Kontrast bestimmte die tägliche Atmosphäre in dem riesigen Straflager. Durch Grubenunglücke oder sonstige Todesfälle fehlende Arbeiter wurden durch Neuzugänge immer wieder ergänzt; entlassen wurde auch im vierten Jahr kein einziger. Da war es für mich schwierig, im Lagergottesdienst immer wieder Mut zu machen und zu betonen, dass Gott uns aus dieser Hölle herausholen kann. Der Lageroberst hat mir wohl deshalb erlaubt, alle 14 Tage Gottesdienst zu halten – einen arbeitsfreien Sonntag gab es für uns nicht –, weil er sich davon einen guten Einfluss auf die allgemeine Stimmung versprach. Aber weder die leeren Versprechungen der Lagerleitung noch meine Versuche, all den hoffnungslosen Menschen Mut zu machen, konnten an der miserablen Stimmung etwas ändern.
Eines Tages trat etwas Unvorhergesehenes ein. Es war der 11. Juni 1948. Und es begann am Lagertor. Als ich nach Schichtwechsel mit meiner Arbeitsbrigade dort ankam, rief ein Wachtposten: „Pleny Stumpf k Majoru!“ – D. h., der Gefangene Stumpf zum Major! 0 weh, was war passiert? Ich hörte aus den Reihen meiner Brigade: „Jetzt bist du dran, jetzt hilft dir nur noch Beten!“ In der Tat, wer als Gefangener zum Major musste, hatte exemplarische Strafe zu erwarten. Normale Strafsachen wurden von den Brigadiers erledigt. Ich war mir keiner Schuld bewusst und konnte mir nicht vorstellen, was da auf mich zukommen sollte.
„Major“, dieses Wort hat uns das Fürchten gelehrt. Aber wer war dieser Major? Man höre und staune – es war eine zierliche, hübsche blonde Frau von ca. 45 Jahren. Sie war Lagerärztin, und als Herrscherin über 5000 Mann trug sie stets ihre Majorsuniform. Auffallend war ihr gleichbleibender eiskalter Gesichtsausdruck, wenn sie mit gewohnt strenger Miene durch die Lager- bzw. Mannschaftsräume ging. Lächeln sah man diese resolute Frau nie. Keiner traute sich in ihre Nähe. Meistens ging sie schweigend durch die Räume; geschimpft hat sie nie, dennoch wirkte sie sehr bedrohlich auf uns. Hatte sie z. B. in einem Schrank Speisereste entdeckt, dann wurde der Betreffende nach der Durchsuchungsaktion von einem Wachtposten in ihr Büro geführt. Dort hat sie ihn dann zurechtgewiesen oder es wurde eine Strafe verhängt. Die meisten Strafen hat sie angeordnet, wenn sich jemand politisch geäußert hat oder wenn jemand bei der Arbeit das Kohlesoll nicht erfüllt hatte. Dann waren fünf Tage Bau bei Wasser, trocken Brot und in ständiger Finsternis üblich.
Zu ihr führte mich nun ein Wachtposten, der aber sogleich wieder verschwand. Zaghaft klopfte ich an ihre Tür. Ihr „Herein“ klang laut und energisch. Als ich eintrat, stand sie hinter ihrem Schreibtisch auf, kam freundlich lächelnd auf mich zu und sagte in akzentfreiem Deutsch: „Freu dich, du darfst heute nach Hause!“ Man kann sich meine Verwirrung vorstellen. Hatte ich recht gehört? Sie sah mir meine Zweifel an und wiederholte freundlich lächelnd: „Du darfst heute nach Hause. Dort draußen siehst du einen Lastwagen, und in 20 Minuten bist du auf diesem Wagen. Geh, mach dich fertig und ‘Gute Fahrt!’.“ Als Kohlenhauer stand ich immerhin noch schwarz vom Kohlenstaub vor ihr, nur Augen und Zähne zeigten Weißes. Sollte ich das, was die Majorin gesagt hatte, wirklich ernst nehmen? Es erschien mir einfach unmöglich, ja geradezu unfassbar. Aber was immer auch diese „allmächtige“ Majorin befahl, das hatte auch zu geschehen.
Es war alles wie in einem schönen Traum, als ich nach dieser unerwarteten Begegnung auf die Bude zu meinen 29 Kameraden kam. Wie und was sollte ich ihnen sagen? Die lachen mich doch aus. Ganz gespannt erwarteten sie mich und bestürmten mich mit Fragen: „Was ist los? Was hast du verbrochen? Welche Strafe kommt auf dich zu?“ Ich berichtete ihnen dann von meiner Begegnung mit der freundlichen Majorin und wurde, wie erwartet, ausgelacht. „Jetzt dreht er durch! Er ist verrückt! Er will uns zum Narren halten!“ Als ich dann anfing, meine wenigen Sachen zu packen, waren sie doch sehr irritiert. Einige liefen zum Lagertor, um zu sehen, ob dort wirklich ein Lastwagen stand. Tatsächlich, der war da. Ich befand mich nun in einer eigenartigen, ja fast unwohlen Situation. Einerseits war ich erfüllt von großer Freude, andererseits konnte ich die große Enttäuschung und Traurigkeit meiner Mitgefangenen gut verstehen, die immer noch warten und hoffen mussten. Wie ein Lauffeuer hatte sich die aufsehenerregende Nachricht im Lager verbreitet. Entlassung! – das war das einzige Thema der 5000 Gefangenen.
Als ich mich mit meinen wenigen Habseligkeiten zum Lagertor begab, begleitete mich eine große aufgeregte Menschenmenge. Die auf so wunderbare Weise erhaltene Bibel gab ich einem Kameraden. Auf dem Wagen wurden mir immer mehr Zettel und Papierröllchen mit Heimatanschriften zugeworfen, um die Angehörigen zu benachrichtigen. Hin und wieder hörte ich aus der Menge den erstaunten Ausruf: „Das ist doch der Lagerpastor, der immer behauptet hat: „Gott kann uns aus dieser Hölle herausführen! Warum wird der allein entlassen? Das kann es doch nicht geben.“ Die Lagerärztin hatte von ihrem Fenster aus die Szenerie beobachtet. Als sie zum Lastwagen trat, machten ihr die Gefangenen bereitwillig Platz und erwarteten gespannt auf eine Erklärung. Sie wechselte jedoch nur mit dem Fahrer ein paar Worte, schaute freundlich lächelnd zu mir auf, winkte mit einer kaum merklichen Handbewegung, als wolle sie, wie schon in der Baracke sagen: „Fahr wohl!“ Auf ihren Befehl hin öffnete sich für mich, einen einzigen Mann, nach langen Jahren Gefangenschaft das riesige Gefängnistor aus Holzbohlen und Stacheldraht. Was war das für ein schicksalhafter Augenblick in meinem jungen Leben, als das große Gefangenenlager langsam meinen Augen entschwand!
Das Lager hatte ich nun zwar hinter mir, war aber noch lange kein freier Mann. Das wurde mir sehr bewusst, als ich in der nächsten Kommandantur einer gründlichen Durchsuchung unterzogen wurde. Dort kam ich in größte Not und Verlegenheit, denn ich war ja immer noch in russischer Gefangenschaft. Ich hätte allerdings wissen müssen, was mir noch bevorstand. In der Kommandantur wurde ich völlig entkleidet und von Kopf bis Fuß durchsucht. Ich wusste, was sie bei mir suchten, denn sie hatten ihre Erfahrung. Es ging um versteckte schriftliche Notizen oder Anschriften. Wohin nun mit meinen drei bis vier Zentimeter breiten Papierröllchen? Es war mein Glück, dass in jenem Raum noch andere vier Gefangene durchsucht wurden und so galt die Aufmerksamkeit nicht mir alleine. An der Wand stehend bemerkte ich eine Kiste; und die schien mir die Lösung zu sein. In einem Augenblick war es mir möglich, mich unbemerkt meiner Zettel zu entledigen, indem ich sie kurz entschlossen zwischen Wand und Kiste warf. Meine Heimkehr wäre schon an diesem ersten Tag, d. h. nach wenigen Stunden beendet gewesen, hätte man bei mir etwas Unerlaubtes gefunden. Wie gerne hätte ich meinen zurückbleibenden Kameraden ihre Wünsche erfüllt und Angehörige besucht oder benachrichtigt. Von jener Kommandantur wurde ich zu einem Bahnhof gebracht und dort allein in einem Güterwaggon verfrachtet, in dem ich auf der langen Fahrt auf einem Strohlager kampiert habe. Ich wusste weder Uhrzeit noch kannte ich die mir endlos erscheinende Fahrtroute. Hin und wieder wurde ich abgekoppelt und auf ein Abstellgleis geschoben; und dann, oft mitten in der Nacht, gab es einen Ruck, und es ging weiter. Wie gut, dass die Julisonne fast täglich schien und ich so bei offenem Waggon, die Beine nach außen baumeln lassend, mich wie auf Urlaubsfahrt fühlte. Erstaunt war ich über meine gut organisierte Verpflegung. Hatte da die Majorin ihre Hände im Spiel? 23 Tage und Nächte fuhr ich durch das weite Russland, bis ich endlich am 4. Juli 1948 in Frankfurt/Oder meinen Fuß auf deutschen Boden setzen konnte. Erst hier verschwanden die mich unauffällig begleitenden russischen Wachtsoldaten endlich. Dieses Gefühl der endgültigen Freiheit ist unbeschreiblich!
Erst Ende 1949 wurde das Lager völlig aufgelöst, und ich bekam Besuch von einem meiner ehemaligen Stubenkameraden. Er berichtete mir von dem Unmut der Kameraden darüber, dass damals nur ein Mann entlassen wurde und von der offenen Frage: Warum? Für mich war es nicht nur eine große Erleichterung und Freude zu hören, dass alle anderen auch nach Hause durften; sondern auch eine wunderbare Glaubenserfahrung: „Gott aber kann, bei ihm ist kein Ding unmöglich!“
Walter Stumpf, Neustadt an der Weinstraße
[1] Quelle: Werner Gitt: Wunder und Wunderbares, CLV-Verlag, 2. Auflage 2007, S. 239-242
[2] Quelle: Werner Gitt: Wunder und Wunderbares, CLV-Verlag, 2. Auflage 2007, S. 242-245
[3] Quelle: Werner Gitt: Wunder und Wunderbares, CLV-Verlag, 2. Auflage 2007, S. 245-248